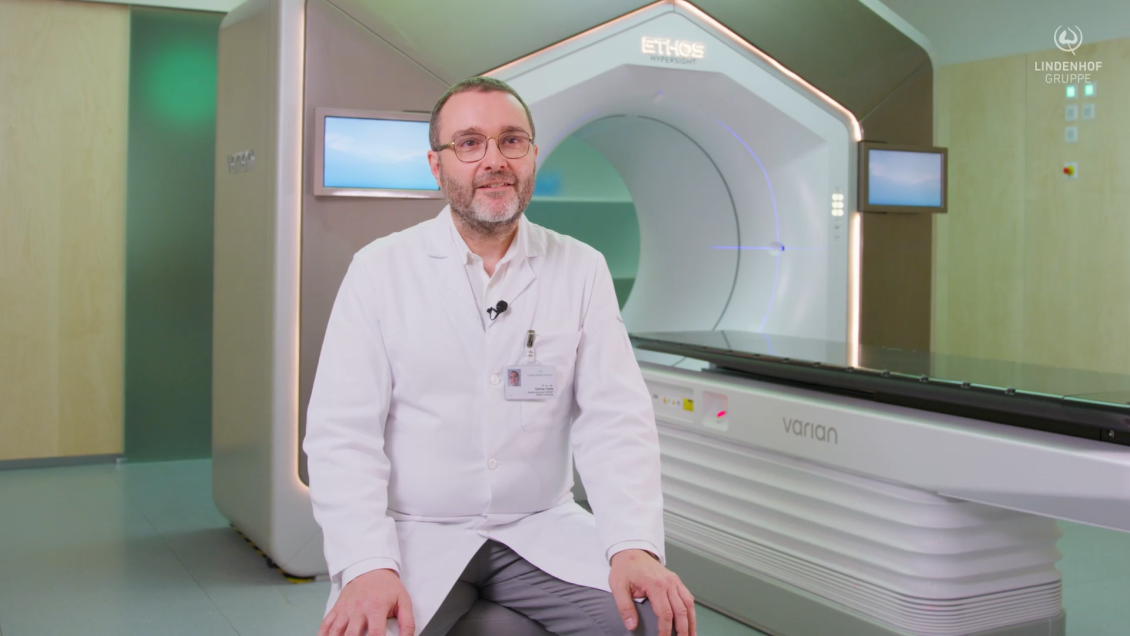Behandlungsqualität
Behandlungsqualität bedeutet für uns weit mehr als medizinische Kompetenz – sie ist Ausdruck von Verantwortung, Betreuung und Menschlichkeit. Jede Person, die sich uns anvertraut, bringt eine persönliche Geschichte, Hoffnungen und auch Ängste mit. Diesem Vertrauen begegnen wir mit Respekt, Aufmerksamkeit und dem Anspruch, die bestmögliche Versorgung zu bieten.
Postoperative Wundinfektionen
Wer die Ursachen kennt, kann besser vorbeugen
Nach einer Operation kann sich die Wunde infizieren. Das ist für die Betroffenen belastend. Eine Wundinfektion erfordert zusätzliche Untersuchungen und führt nicht selten zu einem erneuten Spitalaufenthalt. Die Häufigkeit solcher Infektionen ist ein Indikator für die Behandlungsqualität eines Spitals.
In der Schweiz wird die Infektionsrate nach den Vorgaben des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso erfasst. Die Spitäler der Lindenhofgruppe nehmen an dieser Messung teil. Dabei werden nur klar definierte Operationen berücksichtigt. Gezählt werden Infektionen, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff an der Operationsstelle auftreten. Bei Eingriffen mit Implantaten – beispielsweise bei künstlichen Gelenken – ist der Beobachtungszeitraum länger.
Analysieren und Massnahmen ableiten
Die Ergebnisse helfen der
Lindenhofgruppe, Infektionen vorzubeugen und damit die Sicherheit der
Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Auffälligkeiten werden detailliert analysiert,
mögliche Ursachen mit dem medizinischen Fachpersonal besprochen und entsprechende
Verbesserungsmassnahmen umgesetzt. Wie die Lindenhofgruppe bei den erfassten
Operationen im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt abschneidet, zeigen
die folgenden Grafiken.
Die landesweiten Zahlen für das Jahr 2024 werden
voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse aller
teilnehmenden Spitäler sind über die Website «Messergebnisse Akutsomatik – ANQ» einsehbar.
Viszeralchirurgie, Lindenhofspital
Dickdarm
Grafik 1 zeigt die Infektionsraten nach Dickdarmoperationen.
Rektum
Grafik 2 zeigt die Infektionsraten nach Rektumoperationen.
Magenbypass
Grafik 3 zeigt die Infektionsraten nach Magenbypass-Operationen.
Gynäkologie, Engeriedspital
Hysterektomie
Grafik 4 zeigt die Infektionsraten nach einer Gebärmutterentfernung.
Orthopädie, Sonnenhofspital
Laminektomie (ohne Implantat)
Grafik 5 zeigt die Infektionsraten bei Operationen an der Wirbelsäule. 2022 erlitten 0,8% der Patientinnen und Patienten eine Infektion der Wunde.
Laminektomie (mit Implantat)
2023 und 2024 wurden bei Operationen an der Wirbelsäule mit Implantat in der Lindenhofgruppe keine Infektionen festgestellt.
Bis zum 30. September 2021 wurde das Auftreten von Infektionen jeweils über ein Jahr hinweg beobachtet. Seither liegt der Beobachtungszeitraum bei drei Monaten.
Hüftgelenk
Grafik 6 zeigt die Infektionsraten bei Operationen an Hüftgelenken.
Bis zum 30. September 2021 wurde das Auftreten von Infektionen jeweils über ein Jahr hinweg beobachtet. Seither liegt der Beobachtungszeitraum bei drei Monaten. Ebenfalls bis zum 30. September 2021 wurden alle Infektionen gezählt, auch wenn nur die Naht infiziert war. Seither werden nur Infektionen gezählt, wenn die Prothese infiziert ist.
Kniegelenk
Grafik 7 zeigt die Infektionsraten bei Kniegelenkoperationen.
Bis zum 30. September 2021 wurde das Auftreten von Infektionen jeweils über ein Jahr hinweg beobachtet. Seither liegt der Beobachtungszeitraum bei drei Monaten. Ebenfalls bis zum 30. September 2021 wurden alle Infektionen gezählt, auch wenn nur die Naht infiziert war. Seither werden nur Infektionen gezählt, wenn die Prothese infiziert ist.
Ethos-System
Im Zentrum steht immer der Mensch, nicht die Technik
Das Ethos-System in der Radio-Onkologie der Lindenhofgruppe erweitert die Möglichkeiten zur Bestrahlung von Tumoren. Dank hochqualitativer Bildgebung und KI-Unterstützung kann der Bestrahlungsplan unmittelbar auf Veränderungen im Körper angepasst werden. Das schont das umliegende Gewebe und erhöht die Tumorkontrolle. Im Gespräch: Medizinphysiker Carlos Calle.
Die Lindenhofgruppe verfügt über ein neues Bestrahlungsgerät zur
Tumorbehandlung, das Ethos-System. Das zentrale Element ist der
Linearbeschleuniger. Was ist das?
Ein Linearbeschleuniger
erzeugt hochenergetische Strahlung, die beim Ethos-System in Form von
Röntgenstrahlung zum Einsatz kommt. Damit können wir Tumorzellen zerstören.
Was unterscheidet das Ethos-System von anderen Bestrahlungsgeräten?
Am Lindenhofspital sind
neben dem Ethos-System zwei weitere Linearbeschleuniger im Einsatz. Alle Geräte
basieren auf denselben technischen Grundprinzipien, alle ermöglichen
wirkungsvolle Strahlentherapien auf dem neuesten Stand der Technik. Speziell am
Ethos sind zwei Dinge. Erstens: Die integrierte Bildgebung ist deutlich besser.
Sie liefert qualitativ hochwertige Aufnahmen der betroffenen Körperregion. Zweitens:
Basierend auf diesen Bilddaten kann mittels KI-gestützter Software der
Behandlungsplan während der Therapiesitzung angepasst werden. Wir sprechen von online-adaptiver
Strahlentherapie. Kurz: Das Ethos-System lebt vom Zusammenspiel von Hard- und
Software.
Was bringen die genannten Pluspunkte aus medizinischer Sicht?
In gewissen Körperregionen kann die Therapie individueller, schonender
und effizienter erfolgen. Individueller, weil durch die genaueren Bilddaten die
tagesaktuelle Lage des Tumors und des umgebenden Gewebes besser erkennbar ist und
so die Bestrahlung optimiert werden kann. Schonender, weil durch die präzise
Bestrahlung das gesunde Gewebe rund um den Tumor weniger belastet wird und
damit unerwünschte Nebenwirkungen seltener auftreten. Und effizienter, weil dank
der verbesserten Genauigkeit höhere Strahlendosen verabreicht und so das
gewünschte Resultat mit weniger Therapiesitzungen erzielt werden kann. Das
verkürzt den Behandlungszeitraum. Damit alle Patientinnen und Patienten von der
verbesserten Bildgebung und der hohen Genauigkeit der Bestrahlung profitieren können,
haben wir die anderen Linearbeschleuniger nachgerüstet.
Sie haben gesagt: in gewissen Körperregionen. Welche Krebsarten werden
mit dem Ethos-System behandelt?
Grundsätzlich kann man
alle Krebsarten damit behandeln, die der Radio-Onkologie zugänglich sind. Am
Lindenhofspital bestrahlen wir mit dem Ethos-System primär Tumore im Bauch- und
Beckenbereich. Dort können wir die Vorteile optimal ausspielen, weil wir in
diesen Regionen viel Bewegung haben – beispielsweise durch die Darmtätigkeit
oder die Blasenfüllung. Das bedeutet, dass sich der Tumor nicht immer exakt an
der Stelle befindet, an der er in den vorgelagerten bildgebenden Verfahren
lokalisiert wurde. Dank der beschriebenen online-adaptiven Möglichkeiten können
wir die Bestrahlung während der Sitzung justieren.
Spüren die Patientinnen und Patienten einen Unterschied zur Bestrahlung
mit anderen Linearbeschleunigern?
Während der Bestrahlung
spüren sie nichts. Was anders ist: Der Ethos ist kompakter als die anderen Linearbeschleuniger
und wirkt daher optisch anders – eher wie ein gross geratener Computertomograph.
Und: Wird der Bestrahlungsplan tagesaktuell angepasst, verlängert sich die Behandlungszeit
pro Sitzung – von durchschnittlich 10 auf bis zu 30 Minuten.
Wie sieht es mit dem vorgelagerten Prozess aus? Ändert sich da etwas?
Nein. Wie bei jeder Strahlentherapie gehören zur Indikationsstellung und Vorbereitung
ärztliche Aufklärungs- und Informationsgespräche, bildgebende Verfahren sowie
die Erstellung eines individuellen Bestrahlungsplans, in dem das
Bestrahlungsgebiet, die Strahlendosis und der Schutz des umliegenden Gewebes festgelegt
werden.
Die Bestrahlung ist das eine, die ganzheitliche Begleitung der
Patientinnen und Patienten das andere. Wie wichtig ist das interdisziplinäre
Team bei der Strahlentherapie?
Im Zentrum einer
Strahlentherapie steht immer der Mensch, nicht die Technik. Für eine
erfolgreiche Bestrahlung müssen viele Professionen eng zusammenarbeiten. Die
Fachärztin für Strahlentherapie, die den Patienten betreut und das Behandlungskonzept
erstellt, der Dosimetrist, der darauf basierend einen Bestrahlungsplan
erstellt, die Medizinphysikerin, die den Plan kontrolliert und die Geräte
messtechnisch überwacht, die Radiologiefachfrau, die den Linearbeschleuniger
steuert und die Patientin während der Bestrahlungssitzungen begleitet, bis hin
zu den Mitarbeitenden im Sekretariat, die das Berichtswesen koordinieren, oder
zur Psychoonkologin. Strahlentherapie ist Teamarbeit.
Das Case Management der Lindenhofgruppe
Das Case Management hat uns enorm entlastet
Susanne Marti (83) hat einen Eingriff im Enddarm und eine Chemotherapie hinter sich. Nach dem Spitalaufenthalt kann sie auf unbestimmte Zeit nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Das Case Management der Lindenhofgruppe (siehe Box) hat sie und ihren Sohn Markus bei der Suche nach einer geeigneten Anschlusslösung nach dem Spitalaufenthalt unterstützt.
Frau Marti, wie geht es Ihnen?
Susanne
Marti: Den Umständen
entsprechend. Ich habe noch starke Schmerzen und kann kaum im Rollstuhl sitzen.
Sie haben bis zur notfallmässigen
Einlieferung ins Spital selbstständig gelebt. Wird das auch in Zukunft möglich
sein?
Susanne
Marti: Zunächst werde ich einen
Platz in einem Pflegeheim benötigen. Ob ich je wieder in meinen eigenen vier
Wänden leben kann, bleibt zu hoffen. Ich möchte wie früher wieder stricken und
mit meinen Strickwaren auf den Markt gehen.
Was ist Ihnen in Bezug auf die
Zeit im Pflegeheim besonders wichtig?
Susanne
Marti: Das Wichtigste ist die
Wundheilung, damit ich nicht mehr so starke Schmerzen habe. Deshalb wechsle ich
nach dem Spitalaufenthalt in ein Pflegeheim, das auf Wundheilung und
Schmerztherapie spezialisiert ist.

Herr Marti, das Case Management
der Lindenhofgruppe hat einen entsprechenden Platz für Ihre Mutter gefunden.
Wie haben Sie diese Unterstützung erlebt?
Markus Marti: Das war enorm entlastend. Eine Institution zu
finden, die den medizinischen Erfordernissen entspricht, setzt Fachwissen und gute
Kenntnisse der einzelnen Institutionen voraus. Zudem ist die Suche zeitaufwendig.
Aber das Case Management hat sich um alles gekümmert. Innerhalb einer Woche
wurden uns drei geeignete Pflegeheime vorgeschlagen.
Welche Überlegungen machen Sie
sich mit Blick auf die künftige Wohnsituation Ihrer Mutter?
Markus
Marti: Die Wundheilung hat –
wie meine Mutter gesagt hat – Priorität. Danach braucht es eventuell eine
weitere Operation. Wie es danach weitergehen wird? Darüber mache ich mir noch
keine Gedanken.
Ein Pflegeplatz kostet. Hilft
Ihnen das Case Management auch, finanzielle Fragen zu klären?
Markus
Marti: Bisher wurden uns immer
alle Fragen kompetent und verständlich beantwortet – das wäre bestimmt auch bei
finanziellen Fragen so. Aber meine Lebenspartnerin arbeitet in der Pflege und hat
eine vergleichbare Situation mit ihrer Mutter erlebt. Dank dieses Know-hows können
wir die finanziellen Aspekte eigenständig regeln.
Was bedeutet es für Sie, dass die
Lindenhofgruppe ein Case Management anbietet?
Markus
Marti: Ich bin beruflich stark eingespannt
und deshalb froh um jede Entlastung. So bleibt mir mehr Zeit, mich um meine
Mutter zu kümmern. Auch die Bürokratie bleibt mir erspart … (lacht). Und: Die
fachliche Expertise gibt uns Sicherheit bei unseren Entscheidungen.
Deckt
das Case Management Ihre aktuellen Bedürfnisse ab oder gibt es Bereiche, in
denen Sie sich mehr Unterstützung wünschen würden?
Markus
Marti: Nein,
wir sind zu einhundert Prozent zufrieden.
Wir verfügen über ein starkes Netzwerk
Das Case Management der Lindenhofgruppe begleitet die Familie Marti. Susanne Werder, Leiterin des Case Management-Teams, und Case Managerin Kathrin Gribi berichten, wie sie den Fall erleben und worauf sie in ihrer täglichen Arbeit Wert legen.
Vor welcher Ausgangslage
standen Sie bei der Begleitung der Familie Marti?
Kathrin Gribi: Kurz nach dem Eintritt
von Frau Marti mussten wir eine Nachsorgeplanung einleiten, da sich ihr
Gesundheitszustand verschlechtert hatte – insbesondere in Bezug auf die Wunde
und die Schmerzsymptomatik. Dies führte zu einer stationären Aufnahme. Der
behandelnde Arzt erteilte uns den Auftrag, eine geeignete Anschlusslösung zu
finden, da eine Rückkehr in die eigene Wohnung vorläufig ausgeschlossen ist.
Welche Hilfestellungen
können bzw. konnten Sie Frau Marti und ihrer Familie anbieten?
Kathrin Gribi: Wir konnten eine Pflegeinstitution
vermitteln, die mit der komplexen gesundheitlichen Situation professionell umgehen
kann. Aktuell bilden wir die Schnittstelle zwischen dem Heim und den
Angehörigen. Wir sichern den Informationsfluss zwischen den Beteiligten und sorgen
dafür, dass der Übertritt reibungslos erfolgen kann. Das beinhaltet, dass die
Pflegeinstitution die ärztliche Nachsorgeverordnung kennt und wir Frau Marti in
Sachen Wundberatung weiterhin begleiten.

Ist die Unterstützung der
Familie Marti ein typischer Fall für das Case Management der Lindenhofgruppe?
Susanne Werder: Ja. Allerdings beraten
wir Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige oft auch in finanziellen
Fragen, die mit der angestrebten Pflegesituation zusammenhängen. Meist müssen
Entscheidungen in kurzer Frist gefällt werden, damit der Übertritt geplant und
vollzogen werden kann.
Was ist das Besondere am
Unterstützungsangebot des Case Managements?
Susanne Werder: Wir verfügen über ein
starkes Netzwerk und kooperieren unter anderem mit Pro Senectute, der
Krebsliga, dem mobilen Palliativdienst und der Spitex. So kennen wir die
verfügbaren Angebote und können unsere Leistungen gezielt weiterentwickeln.
Was ist Ihnen persönlich
wichtig, wenn Sie Menschen beim Austritt aus dem Spital begleiten?
Susanne Werder: Auch wenn die
Aufenthaltsdauer in den Spitälern immer kürzer wird: Der Mensch sollte immer im
Zentrum stehen. Zeitdruck und administrative Aufwände dürfen nicht auf die
Patientinnen und Patienten oder ihre Angehörigen abgewälzt werden. Ebenso
wichtig ist, dass wir für jede Person eine Anschlusslösung finden, die ihrer
aktuellen sozialen, psychischen oder physischen Situation gerecht wird.
Wann sind Sie zufrieden mit
Ihrer Arbeit?
Kathrin Gribi: Wenn uns Patientinnen
und Patienten oder Angehörige zurückmelden, dass die Anschlusslösung
funktioniert und keine Fragen mehr bestehen. Wo es noch Unklarheiten gibt,
nehmen wir diese ernst und gehen ihnen nach.
Case Management der Lindenhofgruppe
Das Case Management der
Lindenhofgruppe bietet während des Spitalaufenthalts und darüber hinaus
freiwillige und kostenlose Unterstützung bei sozialen, pflegerischen und
organisatorischen Herausforderungen. Ein interdisziplinäres Team aus
Fachpersonen berät Patientinnen, Patienten, Angehörige und Fachkräfte bei der
Nachsorge sowie bei rechtlichen oder finanziellen Fragen. Die Anmeldung erfolgt
in der Regel durch die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt.
Mehr erfahren